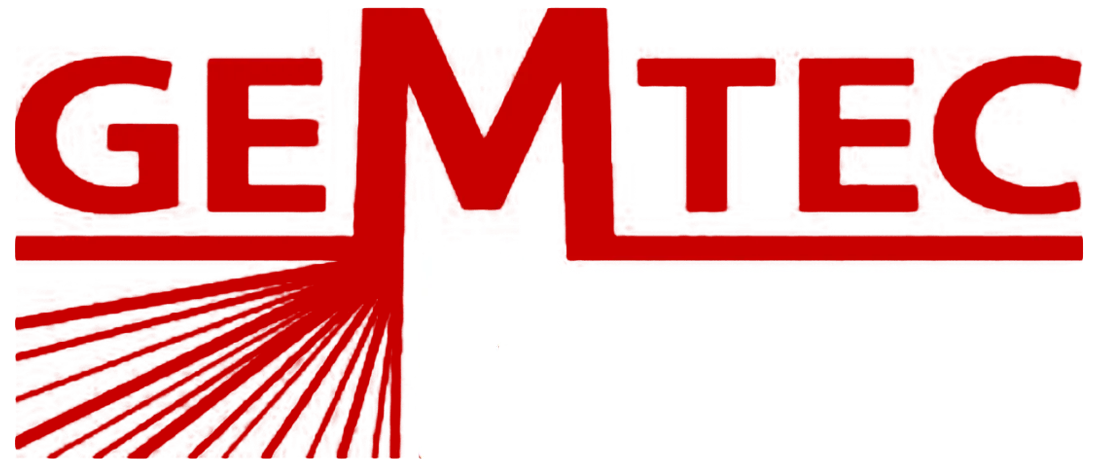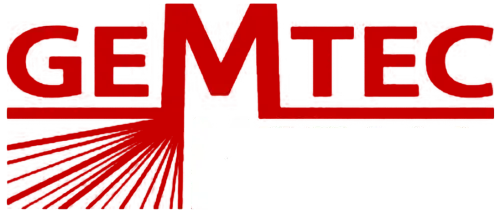Blech biegen – Verfahren, Materialwahl und optimale Biegeradien

Dieser umfassende Leitfaden erklärt, wie Blech präzise gebogen wird. Er behandelt grundlegende Prinzipien, verschiedene Biegeverfahren wie Luftbiegen, Gesenkbiegen und Rundbiegen, gibt Tipps zur Materialwahl und zeigt, wie der optimale Biegeradius berechnet wird. Auch manuelles Biegen, Verbindungsarten, häufige Fehler und die Anwendung im modernen Leichtbau werden erläutert.
Blech ist ein universeller Werkstoff: Es wird in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Architektur, im Haushalt und in der Kunst verwendet. Ohne das Biegen von Blech wären viele Produkte unseres Alltags nicht denkbar – vom Gehäuse des Notebooks über die Karosserie des Autos bis hin zu Lüftungskanälen und Treppengeländern. Beim Blechbiegen wird ein flaches Metallstück plastisch verformt, um ihm eine dauerhafte dreidimensionale Form zu geben. Diese Umformung findet statt, ohne das Material zu durchtrennen; dadurch bleibt seine Struktur und Festigkeit erhalten.
In diesem Leitfaden werden Sie mit den Grundlagen des Blechbiegens vertraut gemacht. Wir erklären, wie Materialeigenschaften, Biegeradien und Verfahren zusammenhängen, stellen unterschiedliche Maschinen und Techniken vor und zeigen, welche Faktoren über den Erfolg beim Biegen entscheiden. Am Ende kennen Sie die wichtigsten Schritte, um Bleche richtig zu biegen, und können das Wissen in der Praxis anwenden, sei es in der Werkstatt oder bei der Planung von Bauteilen.
Grundlagen des Blechbiegens
Beim Biegen wird das Material zwischen zwei Werkzeugelementen verformt: einem Stempel und einer Matrize. Diese Werkzeuge legen die Form des gebogenen Bleches fest. Wenn der Stempel auf das Blech drückt, entsteht eine Umformung: Die Außenseite der Biegung wird gestreckt, die Innenseite gestaucht. Nach Überschreiten der Streckgrenze bleibt die Verformung dauerhaft (plastisch). Der Bereich im Material, der sich weder streckt noch staucht, wird Neutralfaser genannt.
Wichtige Begriffe und Parameter beim Blechbiegen:
- Biegewinkel: Der Winkel zwischen den beiden Blechteilen nach der Umformung. Typische Winkel sind 90°, 45° oder 135°, aber auch freie Winkel sind möglich.
- Biegeradius: Der Innenradius der Biegung. Ein zu kleiner Biegeradius kann Risse oder Brüche verursachen, ein zu großer Radius erhöht das Bauteilmaß.
- Blechdicke: Entscheidend für die Wahl des Biegeradius, des Werkzeugs und der benötigten Kraft.
- Materialeigenschaften: Härte, Zähigkeit, Umformgrad und Rückfederungsverhalten beeinflussen das Biegeergebnis.
- Rückfederung: Nach Entlastung des Werkzeugs springt das Material leicht zurück. Bei weichen Blechen ist dieser Effekt stärker; er muss bei der Werkzeugprogrammierung berücksichtigt werden.

Materialien – Biegungseigenschaften
Verschiedene Metalle reagieren unterschiedlich auf Biegebelastungen. Beim Biegen werden sie gedehnt und gestaucht. Wie gut sie diese Beanspruchungen vertragen, hängt von ihrer Zugfestigkeit, Dehngrenze, Duktilität und dem Gefüge ab.
Stahlblech
Stahlbleche sind zäh und haben eine hohe Festigkeit. Unlegierte Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt lassen sich gut biegen. Warmgewalzte Bleche besitzen oft eine rauere Oberfläche, während kaltgewalzte Bleche glatter und fester sind. Für typische Baustähle gilt: Der Innenbiegeradius sollte mindestens das Ein- bis Anderthalbfache der Blechdicke betragen. Bei hochfesten Stählen oder Edelstahl muss der Radius größer gewählt werden, um Rissbildung zu vermeiden.
Edelstahl
Edelstahl (Rostfreier Stahl) ist korrosionsbeständig und wird im Lebensmittelbereich, in der Medizin und in der Architektur eingesetzt. Er ist fester als normaler Baustahl, aber auch spröder. Beim Biegen von Edelstahl sollte man mit größeren Biegeradien und geringeren Umformgeschwindigkeiten arbeiten. Ein Innenbiegeradius von 1,5 bis 3-facher Blechdicke ist zu empfehlen.
Aluminium
Aluminium ist leicht, weich und besitzt eine gute Korrosionsbeständigkeit. Es lässt sich gut biegen, neigt aber dazu, zu reißen, wenn der Radius zu klein ist. Die Biegeeigenschaften variieren je nach Legierung: Weiche Legierungen (z. B. 1050) können eng gebogen werden, während harte Legierungen (z. B. 7075) größere Radien benötigen. Als Faustregel sollte der Innenradius bei Aluminium mindestens 2 × Blechdicke betragen. Bei besonders spröden oder harten Legierungen kann ein Faktor von drei erforderlich sein.
Kupfer und Messing
Kupfer und Messing lassen sich gut biegen und eignen sich für Dekor, Installationen und Elektrobauteile. Sie sind weich und duktil. Für Kupfer bleche reicht ein Innenbiegeradius von 1,5 × Blechdicke, für Messing bleche ist ein Faktor von 2 oder mehr sicherer, da Messing etwas spröder ist.
Biegeradius – Berechnung und Bedeutung
Der Biegeradius ist entscheidend für die Qualität der Biegung und die Lebensdauer des Werkstücks. Ein zu kleiner Radius führt zu Rissen an der Innenseite; ein zu großer Radius verschwendet Material und Platz. Wie findet man den optimalen Radius?
Abhängigkeit von der Blechdicke
Die einfachste Regel lautet: Der minimale Innenbiegeradius entspricht mindestens der Blechdicke. Bei Stahl mit niedriger Streckgrenze kann der Radius sogar leicht kleiner sein, während bei Aluminium oder Edelstahl der Radius mindestens der doppelten Blechdicke entsprechen sollte. Dies liegt daran, dass Materialien mit geringerer Duktilität (weniger Dehnungsreserven) einen größeren Radius benötigen, um die Dehnung an der Außenseite zu begrenzen.
Materialfaktor (K-Wert)
In der Praxis wird der minimale Biegeradius oft als K‑Faktor multipliziert mit der Blechdicke angegeben. Der K‑Faktor hängt vom Material und der Festigkeit ab. Beispiele für K‑Faktoren:
- Aluminium: 2–3
- Weicher Stahl: 1–1,5
- Edelstahl: 1,5–3
- Messing/Kupfer: 1,5–2
Beispiel: Bei 2 mm starkem Aluminium und einem K‑Faktor von 2 beträgt der minimale Innenradius 4 mm.

Biegezugabe und neutrale Faser
Bei der Kalkulation der Abwicklungslänge muss die Biegezugabe berücksichtigt werden. Das Material um den Biegeradius dehnt sich außen und staucht innen. Die neutrale Faser liegt je nach Materialverhalten und Radius an einer bestimmten Position in der Blechdicke. Der K‑Faktor gibt das Verhältnis zwischen der Lage der neutralen Faser und der Materialdicke an. Er variiert typischerweise zwischen 0,2 und 0,5. Ein K‑Faktor von 0,3 bedeutet, dass die neutrale Faser bei 30 % der Blechdicke vom inneren Radius entfernt liegt.
Die Formel zur Berechnung der Biegezugabe lautet:
Biegezugabe = (Biegeradius + K × Blechdicke) × Winkel (in Radiant)
Diese Zugabe wird zur Summe der Schenkel addiert, um die Länge des abgewickelten Blechs zu ermitteln. Bei kleineren Winkeln oder dicken Blechen kann der Einfluss der Biegezugabe erheblich sein.
Rückfederung
Nach dem Biegen springt das Material geringfügig zurück, weil die elastische Verformung einen Teil des Winkels kompensiert. Dies wird Rückfederung genannt. Weiche Materialien wie Aluminium haben eine größere Rückfederung, harte Materialien wie Edelstahl eine kleinere. Um den Zielwinkel zu erreichen, muss daher der Biegewinkel überbogen werden. Der Überbiegewinkel hängt von Material, Dicke, Werkzeuggeometrie und Prozess ab und wird empirisch oder mithilfe von Biegetabellen ermittelt. Moderne CNC‑Pressen können den Überbiegewinkel automatisch berechnen und anpassen.
Biegeverfahren
Es gibt zahlreiche Biegeverfahren, die je nach Form, Material, Stückzahl und Maschine gewählt werden. Die wichtigsten Verfahren sind Luftbiegen, Gesenkbiegen, Prägebiegen, Schwenkbiegen, Rundbiegen und Walzbiegen. Jedes Verfahren hat seine Besonderheiten, Vor- und Nachteile.
Luftbiegen (Air Bending)
Beim Luftbiegen befindet sich das Blech nur an drei Punkten in Kontakt mit dem Werkzeug: an den Matrizenkanten und an der Stempelspitze. Der Stempel drückt das Blech nicht vollständig bis auf den Boden der Matrize. Dadurch können verschiedene Winkel mit einem Werkzeugsatz realisiert werden.
Vorteile:
- Flexibel: Ein Werkzeug kann mehrere Winkel erzeugen, da der Hubweg variiert.
- Geringe Werkzeugkosten, da weniger Matrizen erforderlich sind.
- Geringere Biegekraft nötig als beim Prägebiegen.
Nachteile:
- Nicht ganz so präzise wie Gesenk- oder Prägebiegen.
- Die Rückfederung ist größer, daher müssen Korrekturen vorgenommen werden.
Luftbiegen eignet sich für kleine und mittlere Stückzahlen sowie für Bauteile mit unterschiedlichen Winkeln.
Gesenkbiegen (Bottoming)
Beim Gesenkbiegen drückt der Stempel das Blech bis in den Boden der Matrize. Der Winkel und der Radius werden durch das Werkzeug festgelegt. Es entsteht eine exakte, reproduzierbare Biegung.
Vorteile:
- Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit.
- Geringere Rückfederung als beim Luftbiegen.
Nachteile:
- Für jeden Winkel wird ein eigenes Werkzeug benötigt, was Kosten und Rüstzeiten erhöht.
- Höhere Kräfte erforderlich.
Gesenkbiegen wird bei Serienteilen mit konstanten Winkeln verwendet, bei denen enge Toleranzen gefragt sind.

Prägebiegen
Dieses Verfahren ist dem Gesenkbiegen ähnlich, jedoch wird das Blech tief in die Matrize geprägt. Der Stempel und die Matrize umfassen das Material vollständig, wodurch ein definierter Winkel und Radius entstehen. Prägebiegen eignet sich besonders für kleine Innenradien und komplizierte Geometrien. Da das Material vollständig umschlossen wird, sind die Kräfte und der Werkzeugverschleiß höher.
Schwenkbiegen (Schwenkbiegeautomat)
Hier wird das Blech zwischen Ober- und Unterwerkzeug eingespannt. Ein Schwenkbalken hebt oder senkt sich und biegt das freie Schenkelende um den Balken. Schwenkbiegen eignet sich für dünne Bleche (z. B. Aluminium, Zink, Kupfer) und ermöglicht das Biegen komplexer Profile, auch mit mehreren, gegensätzlich gerichteten Biegungen. Es ist besonders beliebt im Bereich der Blechverkleidungen wie im Gehäusebau oder Fassadenbau.
Vorteile:
- Schonende Bearbeitung ohne Kratzer, da keine Matrizen reiben.
- Hohe Wiederholgenauigkeit.
- Auch große Bauteile können einfach gehandhabt werden, da das Blech auf dem Tisch liegt.
Nachteile:
- Begrenzte Materialstärken.
- Lange Biegekanten erfordern leistungsstarke Maschinen.
Rund- und Walzbiegen
Rundbiegen erzeugt zylindrische oder konische Formen. Beim klassischen Rundbiegen wird das Blech mehrmals hintereinander gebogen, bis der gewünschte Radius entsteht. Walzbiegen erfolgt mit drei oder vier Walzen: Das Blech wird zwischen Walzen geführt, die über ihre Position den Radius bestimmen. Walzbiegen ermöglicht präzise, gleichmäßige Kurven – von kleinen Rohrdurchmessern bis zu großen Tanks.
Vorteile:
- Große Radien möglich.
- Gute Oberflächengüte, da das Blech kontinuierlich verformt wird.
Nachteile:
- Für kleine Radien ist es nicht geeignet.
- Bei kleinen Losgrößen ist das Einrichten der Maschine aufwendig.
Profilbiegen und Rollbiegen
Beim Profilbiegen werden spezielle Profilstäbe (U‑Profile, T‑Profile, Winkel, Rohre) gebogen. Rollbiegen ist eine Variante, bei der das Material durch aufeinanderfolgende Rollen mit geringem Radius mehrfach umgeformt wird. Dadurch entsteht allmählich der gewünschte Radius. Rollbiegen eignet sich für große Stückzahlen und lange Werkstücke.
Biegen mit Gesenkpressen und Abkantpressen
Die meisten Bleche werden auf Abkantpressen gebogen. Diese Maschinen gibt es in mechanischer, hydraulischer und servoelektrischer Ausführung. Servoelektrische Pressen ermöglichen energiesparendes Arbeiten mit hoher Präzision. Hydraulische Abkantpressen bieten große Presskraft und eignen sich für dicke Bleche. Moderne Maschinen besitzen CNC‑Steuerungen, die Winkel, Hubwege und Rückfederung automatisch korrigieren.
Manuelles Biegen vs. maschinelles Biegen
Handbiegen für Heimwerker und Prototypen
Für kleine Projekte und Reparaturen können Bleche von Hand gebogen werden. Werkzeuge wie Schraubstock, Biegezangen, Falzbein oder Handbiegemaschinen kommen zum Einsatz. Dabei sollte man vorsichtig vorgehen, um die Biegekante gleichmäßig zu belasten. Das Material wird an der gewünschten Stelle zwischen zwei festen Backen eingespannt, überstehenden Teil vorsichtig gebogen und ggf. mit einem Hammer nachgearbeitet.
Handbiegen eignet sich für dünne Bleche bis ca. 1 mm Stärke (Aluminium, Kupfer, Messing). Für Stahlbleche über 1 mm oder komplizierte Konturen ist eine Maschine empfehlenswert, da manuell nicht genügend Kraft aufgebracht wird und die Wiederholgenauigkeit leidet.
Maschinelles Biegen für Präzision und Serien
Bei maschinellem Biegen kommen Abkantpressen, Schwenkbiegeautomaten oder Walzmaschinen zum Einsatz. Sie ermöglichen hohe Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Produktivität. Zudem können sie dickere Bleche und schwierige Werkstoffe bearbeiten. Durch CNC‑Steuerungen lassen sich Programme speichern und abrufen, was bei Serienfertigung unverzichtbar ist.
Wer einen Prototyp für ein Serienprodukt herstellt, sollte frühzeitig eine professionelle Biegemaschine einsetzen, da manuell gefertigte Muster oft nicht exakt reproduzierbar sind.

Verbindungsarten nach dem Biegen
Viele Blechteile werden nach dem Biegen weiterverarbeitet und verbunden. Es gibt unterschiedliche Techniken, um Bleche dauerhaft oder lösbar zu verbinden:
Schweißen
Schweißen ist die gängigste Methode, Bleche zu verbinden. Beim Schweißen werden Materialien miteinander aufgeschmolzen und verschmelzen zu einer festen Verbindung. Verfahren wie MAG‑Schweißen (Metall-Aktivgas), WIG‑Schweißen (Wolfram-Inertgas) oder Laserstrahlschweißen werden je nach Material eingesetzt. Bei dünnen Blechen ist WIG‑Schweißen besonders geeignet, da es saubere und dünne Nähte erzeugt. MAG‑Schweißen wird bei dickeren Stahlblechen eingesetzt.
Nieten
Nieten werden verwendet, wenn eine lösbare Schraubverbindung nicht möglich oder erwünscht ist. Blindnieten lassen sich von einer Seite aus setzen und eignen sich bei schwer zugänglichen Stellen. Stanznieten fügen Bleche durch Umformen, ohne vorbohren zu müssen. Nieten sind vibrationsfest und können unterschiedliche Materialien verbinden.
Clinchen
Beim Clinchen werden zwei oder mehr Bleche durch lokale plastische Verformung miteinander verbunden. Das Verfahren kommt ohne Zusatzmaterial aus. Ein Stempel und eine Matrize pressen die Bleche zusammen, wodurch sich lokale Verwirbelungen bilden und die Bleche ineinander verzahnen. Clinchen eignet sich für Aluminium und Stahl und wird vor allem in der Automobilindustrie verwendet.
Schrauben und Gewindeschneiden
Für lösbare Verbindungen werden Bleche gebohrt und mit Schrauben verbunden. Entweder durch selbstschneidende Schrauben, Einschlagmuttern oder durch Gewindeformen/ -schneiden im Blech. Durch Verwendung von Formschrauben kann auf Muttern verzichtet werden. Schraubverbindungen ermöglichen Montage und Demontage, sind aber nicht immer vibrationsfest.
Kleben
Kleben wird zunehmend im Metallbau eingesetzt. Moderne Klebstoffe sind hochfest und verteilen Lasten gleichmäßig. Beim Blechbiegen kommen sie beispielsweise bei Sandwichpaneelen zum Einsatz. Klebeverbindungen müssen sorgfältig vorbereitet werden (Oberflächenreinigung, Vorbehandlung) und benötigen Zeit zum Aushärten.
Auswirkung des Biegens auf die Bauteillänge
Beim Biegen wird das Blech gestaucht und gestreckt, was die Abwicklungslänge verändert. Für Planer und Konstrukteure ist es wichtig, die finale Länge des geraden Blechs korrekt zu berechnen, um nach dem Biegen die gewünschten Maße zu erhalten.
Abwicklung berechnen
Die Abwicklungslänge setzt sich zusammen aus den Längen der Schenkel plus der Biegezugabe. Die Biegezugabe berücksichtigt, dass die neutrale Faser in einer bestimmten Position innerhalb der Blechdicke liegt. Zur Berechnung werden Tabellen oder Software genutzt, die den K‑Faktor, die Blechdicke und den Winkel berücksichtigen.
Biegezuschlag und Biegerücksprung
Der Biegezuschlag ist die Differenz zwischen der Abwicklungslänge und der Länge der geformten Blechteile. Er wird für jeden Winkel separat berechnet. Der Biegerücksprung beschreibt das Maß, um das der Biegewinkel beim Biegen größer sein muss, um die Rückfederung auszugleichen. Dieser Wert wird in der Maschinensteuerung hinterlegt.
Planung und Konstruktion: Design for Bending (DfB)
Beim Design for Bending wird das Produkt bereits in der Konstruktion so ausgelegt, dass es sich effizient und ohne Qualitätseinbußen biegen lässt. Wichtige Punkte:
- Anzahl der Biegungen minimieren: Jede Biegung kostet Zeit und erhöht das Risiko von Fehlern.
- Biegeradien harmonisieren: Mehrere identische Radien erleichtern die Fertigung.
- Streckrichtung und Walzrichtung berücksichtigen: Bleche haben eine Walzrichtung, entlang der das Blech fester und spröder ist. Biegungen sollten möglichst quer zur Walzrichtung erfolgen, um Rissbildung zu vermeiden.
- Genügend Abstand zwischen Biegungen: Wenn Biegekanten zu nah beieinander liegen, kann das Material sich verformen oder überlappen. Als Faustregel sollte der Abstand zwischen zwei Biegungen mindestens das Zweifache der Blechdicke betragen.
- Innenausschnitte: Öffnungen oder Ausbrüche sollten einen Mindestabstand zur Biegung haben, um Verzerrungen zu vermeiden.
Durch frühzeitige Abstimmung mit dem Blechbearbeiter lassen sich Konstruktionsfehler vermeiden und Kosten sparen.

Qualitätskontrolle und Fehlervermeidung
Nach dem Biegen sind Kontrollen unerlässlich, um Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität zu gewährleisten. Typische Fehlerquellen sind:
- Risse an der Innenseite: treten auf, wenn der Biegeradius zu klein gewählt wurde oder das Material Materialfehler aufweist.
- Maßabweichungen: entstehen durch ungenaue Werkzeugpositionen, falsche Biegeprogramme oder unzureichende Rückfederungskorrektur.
- Knicke oder Falten: wenn die Blechteile nicht korrekt aufgelegt oder fixiert waren oder wenn das Material zu weich ist.
- Oberflächenkratzer: durch verschmutzte Werkzeuge oder fehlende Schutzfolien. Schwenkbiegen und Folien schützen vor Kratzern.
Zur Qualitätskontrolle gehören Messungen mit Messschieber, Winkelmessgerät oder 3D‑Scan sowie visuelle Inspektionen der Biegezone. Bei Serienfertigung wird häufig ein erster Artikel geprüft und als Referenz für die weitere Produktion genommen.
Anwendungen des Blechbiegens
Gehäusebau und Elektronik
Blechgehäuse für Maschinen, Computer, Steuergeräte und Medizintechnik bestehen oft aus gebogenem Stahl oder Aluminium. Durch Biegen entstehen stabile Rahmen, Abdeckungen und Halterungen. Die Kombination aus Laserschneiden und Biegen ermöglicht Gehäuse mit präzisen Öffnungen für Stecker, Lüftungsgitter und Displays.
Fahrzeugbau
In der Automobilindustrie werden Bleche für Karosserieteile, Versteifungsprofile und Halterungen gebogen. Beispielsweise sind Querträger, Schweller und Achsaufnahmen aus gebogenen Stahlblechen gefertigt. Durch Rollformverfahren lassen sich lange Profile für Stoßstangen oder Dachrahmen herstellen. Auch im Nutzfahrzeugbau (Trailer, Lkw-Aufbauten) spielt das Biegen eine wichtige Rolle.
Architektur und Bauwesen
Fassadenverkleidungen, Dachabschlüsse, Fensterbänke und Treppen sind häufig aus gebogenem Blech. Aluminium und Edelstahl verbinden Ästhetik mit Funktion: Sie sind wetterbeständig und formen sich zu modernen, geradlinigen Gebäudeelementen. Auch im Innenausbau werden Bleche für Handläufe, Brüstungen oder Lichtkanäle genutzt.
Lüftung, Klima und Sanitär
Runde oder eckige Lüftungskanäle entstehen durch Walz- oder Schwenkbiegen. Biegen ermöglicht das Herstellen von Bögen, Abzweigen und Übergangsstücken. Für Sanitärinstallationen werden Abdeckblenden, Einbaurahmen oder Halterungen gebogen.
Möbel und Design
Designer schätzen die Freiheit, die das Biegen von Blech bietet. Stühle, Tische, Leuchten oder Kunstobjekte aus gebogenem Stahl oder Aluminium verleihen Räumen ein minimalistisches, modernes Flair. Durch Pulverbeschichtung können Farben und Oberflächen individuell gestaltet werden.
Das Biegen von Blech ist ein vielseitiges Verfahren, das in nahezu allen Industriezweigen Anwendung findet. Die richtige Wahl des Materials, des Biegeradius und des Verfahrens ist ausschlaggebend für die Qualität des Endprodukts. Luftbiegen bietet Flexibilität, Gesenkbiegen höchste Präzision, Schwenk- und Rollbiegen eigene Vorteile für lange und komplexe Formen.
Für das beste Ergebnis sollten Konstruktions- und Fertigungsteams frühzeitig zusammenarbeiten. Ein durchdachtes Design berücksichtigt Materialeigenschaften, Walzrichtung, Biegeradien und Abstände. Professionelle Abkantpressen und qualifizierte Fachkräfte sorgen dafür, dass Bleche in Serie präzise und wirtschaftlich gefertigt werden können.
Mit dem Trend zu Leichtbau, Elektromobilität und modularen Produkten gewinnt das Blechbiegen weiter an Bedeutung. Neue Werkstoffe und Technologien – wie hochfeste Aluminiumlegierungen, Laserhybridschweißen oder automatisierte Biegezellen – eröffnen zusätzliche Möglichkeiten. Für Konstrukteure und Hersteller bleibt es spannend, diese Entwicklungen zu nutzen und innovative Anwendungen zu realisieren.
FAQs
Wie berechne ich den minimalen Biegeradius?
Der Innenbiegeradius sollte mindestens so groß wie die Blechdicke sein. Für Aluminium und Edelstahl empfiehlt sich das Zwei- bis Dreifache der Dicke. Der genaue Wert hängt vom Material, der Legierung und der gewünschten Oberflächenqualität ab.
Was unterscheidet Luftbiegen von Gesenkbiegen?
Beim Luftbiegen berührt das Blech die Matrize nur an den Kanten; der Winkel wird durch den Stempelhub bestimmt. Beim Gesenkbiegen drückt der Stempel das Blech vollständig in die Matrize. Gesenkbiegen ist präziser, erfordert aber für jeden Winkel ein eigenes Werkzeug.
Kann man Blech mit der Hand biegen?
Ja, dünne Bleche aus Aluminium, Kupfer oder Stahl lassen sich mit Handwerkzeugen wie Schraubstock und Biegezange biegen. Für genaue Winkel und dickere Bleche empfiehlt sich jedoch eine Biegemaschine.
Wie beeinflusst die Walzrichtung das Biegen?
Bleche haben eine Walzrichtung, entlang der sie fester und spröder sind. Biegt man entlang der Walzrichtung, kann das Blech schneller reißen. Es ist empfehlenswert, quer zur Walzrichtung zu biegen, um eine gleichmäßige Dehnung zu erreichen.
Warum ist die Rückfederung wichtig?
Nach dem Biegen springt das Material leicht zurück, wodurch der Winkel größer wird als gewünscht. Der Überbiegewinkel muss diesen Effekt kompensieren, damit das Endmaß stimmt. Moderne Maschinen kalkulieren dies automatisch.